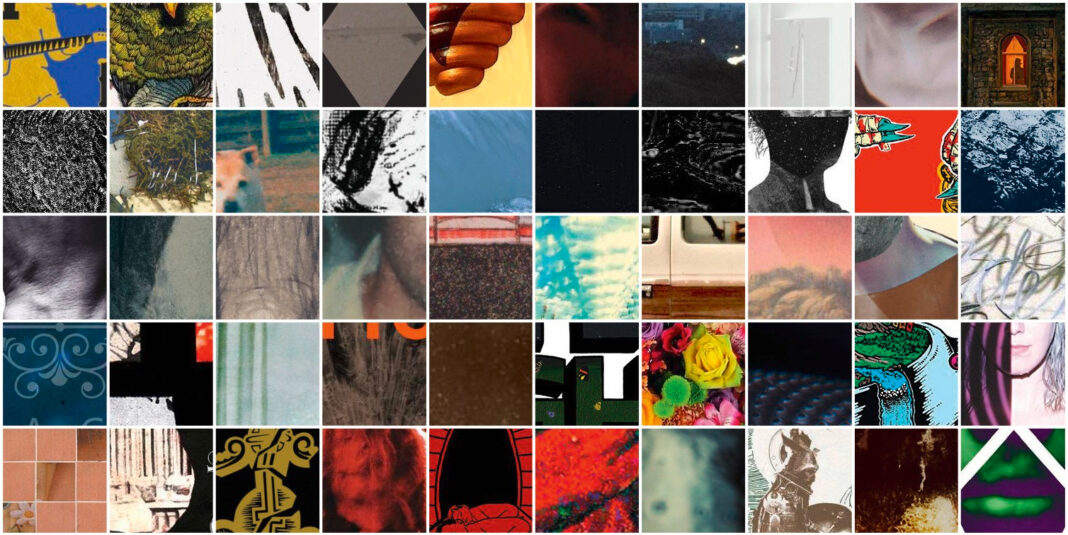Die 2010er: Die Plattenliste
Wir wollten es ja so. 10 Jahre auf 100 Alben runterbrechen, und weil selbst das noch zu leicht gewesen wäre, durften sie natürlich nicht einfach chronologisch sortiert ins Heft. Um das ganze Höllenfahrtskommando mal mit Zahlen zu untermauern: Wenn man zugrunde legt, dass wir pro Ausgabe durchschnittlich 76 Neuveröffentlichungen vorstellen, diese Zahl mal 12 Hefte mal 10 Jahre nimmt, landet man bei exakt 9.120 Alben, die sich zumindest schon mal dadurch für unser großes Dekaden-Ranking qualifiziert hätten, dass wir sie irgendwann in den vergangenen zehn Jahren besprochen haben. Ein gar nicht so unerheblicher Anteil dessen schaffte es dann tatsächlich in den Pool der Kandidaten: Gut 650 Alben standen nach diversen Nennungen, Nachnominierungen und Zwischenrufen zur Auswahl. Und dann wurde gehört, gevotet, gezetert und geschachert, was das Zeug hielt. Natürlich umso verbissener, je weiter es in Richtung Spitzenplätze ging. Jetzt jedenfalls steht es unverrückbar da, unser Best-of der unzähligen Rockalben, die zwischen 2010 und 2019 erschienen sind.




 Die 100 besten Alben der 2010er
Die 100 besten Alben der 2010er