Platte der Woche: Empire State Bastard – “Rivers Of Heresy”

Als Mike Vennart von Oceansize damals mit Biffy Clyro als Live-Gitarrist auf Tour war, schrieben Empire State Bastard ihre Origin-Story, wenn man so will. Bis zur Bandgründung dauerte es dann zwar noch einige Jahre länger, aber nun ist das Debüt da. Von Vennarts und Biffy-Frontmann Simon Neils Vorlieben für Metal, Grindcore und Thrash inspiriert wagte sich die neue Supergroup mit Dummer Dave Lombardo ein experimentelles Album, auf dem sie ihre ganze Wut über den Zustand der Welt entfesseln.
Slowdive – “Everything Is Alive”
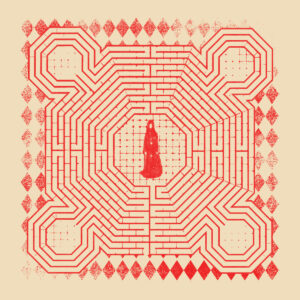
Die Shoegaze-Legenden Slowdive sind mittlerweile länger wiedervereint, als ihre Band beim ursprünglich existiert hatte. Auf ihrer neuen Platte orientieren sie sich an ihrem Ambient-geprägten Werk “Pygmalion”. Delikate Themen wie Verlust oder Trauer behandeln sie dabei so optimistisch, dass Hörer:innen hoffnungsvoll zurückbleiben.
Royal Blood – “Back To The Water Below”
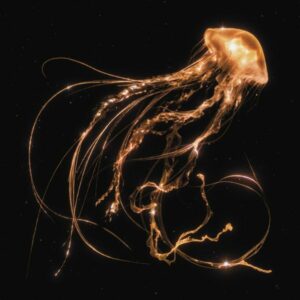
Royal Blood wenden sich vom Disco-Sound des Vorgängers ab, der Sprung zu einer außergewöhnlichen Band gelingt aber wieder nicht. Dennoch sind all ihre Trademarks in Bestform vorhanden: mächtiger Groove, eine lupenreine Produktion und die Spielfreude des Duos. Weil die aber ihre Dramatik zu dick auftragen, verschenken sie wieder ihr Potenzial.
Frankie And The Witch Fingers – “Data Doom”
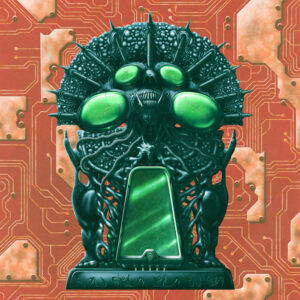
Frankie And The Witch Fingers setzen sich mit einer düsteren Gegenwart und Zukunft auseinander. Ihren SciFi-lastigen Garagerock hüllen sie dabei in ein vielschichtiges, Fuzz-besticktes Gewand. Akzente mit Moog und Saxofon finden ebenso ihren Platz wie Shaker und Mellotron.
Jeff Rosenstock – “Hellmode”

Extreme erleben einige häufiger als andere – Jeff Rosenstocks Musik fehlt es gewiss nicht daran. Wie der Titel vermuten lassen könnte, geht es auf “Hellmode” um Reizüberflutungen, die sich sehr emotional auswirken. Im Indie-Punk, mit dem er seine Probleme zu bewältigen versucht, spiegelt sich das unter anderem durch Effekte und viele Tempowechsel wider.
100 Kilo Herz – “Zurück nach Hause”

Das dritte Album der Leipziger Punk-Band ist politisch, gefühlvoll und baut auf die beiden vorigen Werke auf. Mit hymnischen Bläsern macht sich die Band stark, für den Kampf gegen Rechts und häusliche Gewalt, fühlt den Trott des herausfordernden Alltags und schafft ein Bewusstsein für den Pflegenotstand.
Östro 430 – “Punkrock nach Hausfrauenart”

Auch auf ihrem Comeback-Album verzichten Östro 430 weitestgehend auf Gitarren. Dafür kommen Klavier, Saxofon und Akkordeon zum Einsatz – und natürlich der obligatorische Humor, mit dem sie seit den 80er-Jahren gegen Rollenbilder vorgehen. Eine Band, für die Feminismus nichts mit Privilegien, sondern mit Gleichberechtigung zu tun hat.
Hey Colossus – “In Blood”

“In Blood” ist das poppigste Album, das Hey Colossus in den letzten zwei Jahrzehnten hervorgebracht haben. Auf ihren mystisch-unheilvollen Ton verzichten sie allerdings nicht. Ebenso wenig auf hymnische Refrains und reduzierte Instrumentierung (“Curved In The Air”). Ein Album zwischen Entschleunigung und der Liebe zur Melodie.
Leopard – “Überleben”

Mit zappeligen Indierock-Songs aus der Garage zeigen Leopard, wie sehr sie auf Krawall gebürstet sind. Die Mischung aus Kraftklub, Bilderbuch und The-Kinks-Anspielungen (“Geht es dir noch gut?” macht sich gut, wenn die Berliner ihren Unmut über Fehlstände in der Gesellschaft zwischen Exzess und Resignation kundtun.
Taking Meds – “Dial M For Meds”

Vom Hardcore zum Indierock der frühen 90er heißt es für Taking Meds. Sie sind nicht mehr länger die poppigste Band auf der Hardcore-Show oder aber aggressivste Band auf der Pop-Punk-Show. Auf “Dial M For Meds” legen den Fokus ihrer bitteren Pillen wieder vermehrt auf Melodien.
Pale Blue Eyes – “This House”

Pale Blue Eyes beschäftigen sich mit den verschiedenen Ebenen der Trauerbewältigung, ohne die Hoffnung zu verlieren. Synthies und weite Instrumentalflächen sowie mehrdimensionaler Gesang kommen dabei zum Einsatz. Dem Closer werden dann sieben Minuten eingeräumt – genug Zeit, um sich zu entfalten.
Polaris – “Fatalism”

“Fatalism” von Polaris wird von einem düsteren Grundtenor bestimmt. Dabei sind die Riffs brutal bis verspielt, der Blick nach innen gerichtet. Überschattet vom Tod ihres Gitarristen, scheint die Platte durch die unmittelbaren Texte und den zeitgenössischen Metalcore-Sound am Ende wie das Vermächtnis von Ryan Siew.



