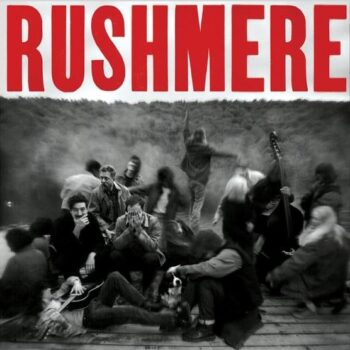Mumford & Sons
Wilder Mind

Sonst hätten sich die Briten für ihr drittes Album wohl kaum auf den gleichen Irrweg gemacht wie zuvor schon ihre Landsleute Coldplay. Die hatten vor einer Dekade die Indie- bis Rockwelt mit zwei charmanten Alben voller intimer Songwriter-Kleinode eingesackt – und ihren Sound ab der dritten Platte “X&Y” sukzessive für die ganz großen Pop-Bühnen und das Format-Radio glattgeschliffen, bis Avicii und Co. vom frühen Charme der Band nur noch eine fahle Erinnerung übrig gelassen haben. Auch für Mumford & Sons ist es das dritte Album, auch sie wählen den Weg ins Herz der Popmusik: Verhallte E-Gitarren statt Akustikklampfe, flächige Synthesizer-Betten statt euphorischer Banjo-Parts und ein uniformer 80er-Sound statt der alten 60er-Folker bilden die Grundlage für “Wilder Mind”. Das klingt den größten Teil der Zeit und ganz besonders in der ersten Single “Believe” dann, als ob einem zu Bruce Springsteens “Tunnel Of Love” die Füße eingeschlafen wären, oder der Teufel einem zeigen wollte, wie die Mumford & Sons klingen, die perfekt zwischen U2 und den späten Kings Of Leon in die Radio-Hölle passen. “Wilder Mind” ist dabei nicht mal ein aggressiv schlechtes Album: Die zart glühende Synthie-Ballade “Monster”, “Snake Eyes” oder “Ditmas” erkennt man trotz des Sound-Fiaskos als Songs mit Potenzial. Leider ist die Instrumentierung überall so entsetzlich spannungsarm und gleichförmig geraten, dass nur die wenigsten Rock-Hörer Lust haben dürften, sich bis zu dieser Erkenntnis hin zu langweilen.