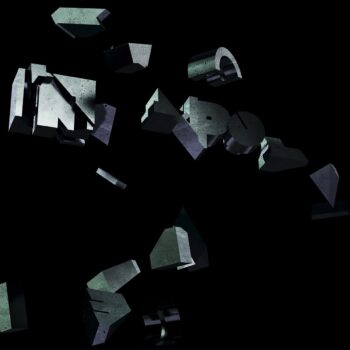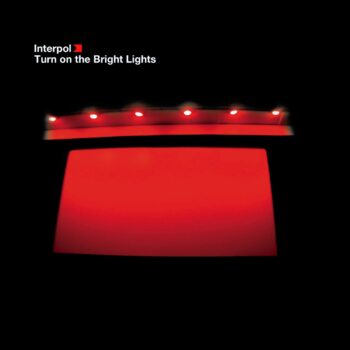Auf dem zweiten Album als Trio verschieben Interpol den Fokus auf Lautstärke, Tempo und: Hits. Zugegeben, dem Besonderen ihrer Musik wird man nicht mit den klassischen Rock-Attributen gerecht, geht es doch bei Interpol ums atmosphärisch düstere Gesamtbild. Das grobkörnige Knistern zwischen den Tönen ist auch auf “Marauder” nicht verschwunden, es wird nur ruckartig von Verstärkermembranen in Schwingung gebracht. Die Promo-Abteilung freut sich über zerstörte Schlagzeugteile und Ruhestörung rund um den Proberaum der Yeah Yeah Yeahs. Hören kann man davon auf dem sechsten Album der New Yorker tatsächlich etwas, nämlich in Form einer nie dagewesenen Spielfreude, die sicher auch aus der Jubiläumstour zu Interpols Debüt resultiert. Nach dem ungewohnt direkt zum Punkt kommenden Opener “If You Really Love Nothing” und dem alles niederrollenden “The Rover” traut man Daniel Kessler im dritten Song sogar die Westerngitarre zu, die sich nach wenigen Sekunden mithilfe der Rhythmusfraktion dann doch als Post-Punk entpuppt. “Mountain Child” steigert sich nach zwei Minuten in eine Krachorgie, die in einer Melodie aus einem Iron-Butterfly-Fiebertraum mündet. In “NYSWA” spielt Schlagzeuger Sam Fogarino endlich so vertrackt, wie es die Vergleiche mit The National schon immer nahelegten. Und Paul Banks findet elfmal genau den richtigen Refrain. Spätestens jetzt ist die Bassfrage egal. Bleibt nur offen, ob “Marauder” trotz seiner dunklen textlichen Offenbarungen als Sommeralbum durchgeht.
9/12 Christian Wiensgol
Selbstplünderung hat bei Interpol Methode. Das sechste Album lässt die persönlichen Wertsachen im Safe. Von welchen todernsten, flotten und gutangezogenen Bands sich Interpol ursprünglich mal die Stile geliehen haben, ist nach 20 Jahren langsam kein Thema mehr, dafür bedienen sich die New Yorker umso mehr bei sich selbst. Wo “El Pintor” 2014 noch die Aufregung um den abgehauenen Bassisten in umso entschlossenere Songs steckte, hat “Marauder” kaum irgendwas Neues zu verarbeiten. Die mal mittelschnellen und mal mittellangsamen Rhythmen wippen den eindringlichsten Zeiten der Band hinterher wie ein kreislaufschwacher Cowboy, und auch Paul Banks scheinen bei aller prägnanten Tragik in der Stimme immer wieder die Augen zuzufallen. “It Probably Matters” hat er den Abschlusssong des Albums genannt, aber was und inwiefern und ob jetzt wirklich wird bei allen bedeutungsschweren Andeutungen nicht klar. Die Band, die immer dann am mitreißendsten war, wenn sie extra unterkühlt, ehrlich verletzt oder zu Recht triumphierend klang, klaubt sich fürs sechste Album die Füller von früher zusammen, die erst recht niemand sonst wollte. Bei Songs wie “Surveillance” scheinen Interpol endgültig zu vergessen, dass sie mal einige der besten Indiedisco-Refrains geschrieben haben, und wiegen sich stattdessen in schläfrigem Rock inklusive Schellenkranz und ganz viel Gemurmel. Man muss kein Webcam-Hacker sein, um zu sehen, wie Interpol viele Tabs offen hatten, um dann versehentlich die richtigen zu schließen.
5/12 Britta Helm
weitere Platten
The Other Side Of Make-Believe
VÖ: 15.07.2022
A Fine Mess (EP)
VÖ: 17.05.2019
El Pintor
VÖ: 05.09.2014
Interpol
VÖ: 03.09.2010
Our Love To Admire
VÖ: 06.07.2007
Antics
VÖ: 27.09.2004
Turn On The Bright Lights
VÖ: 19.08.2002