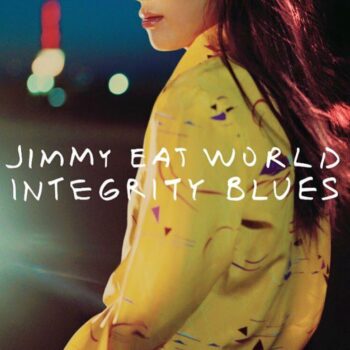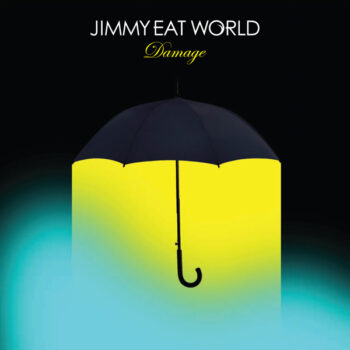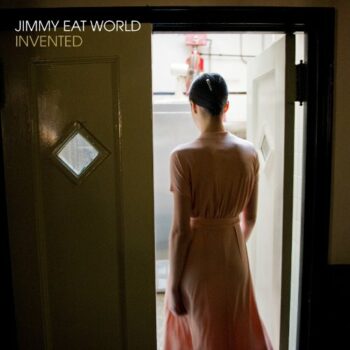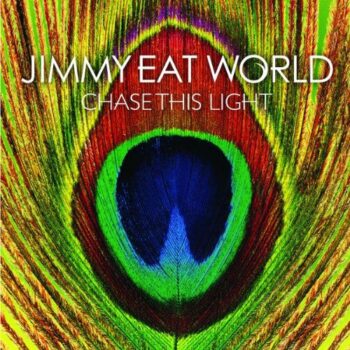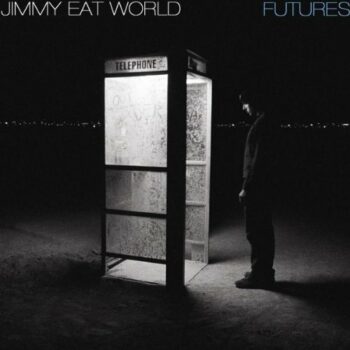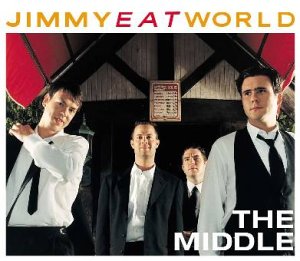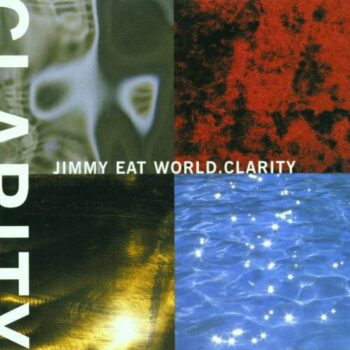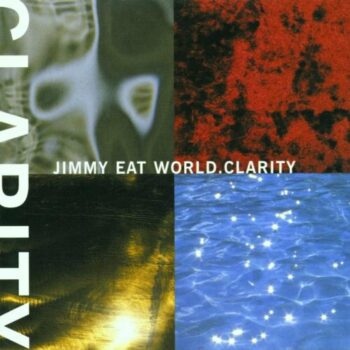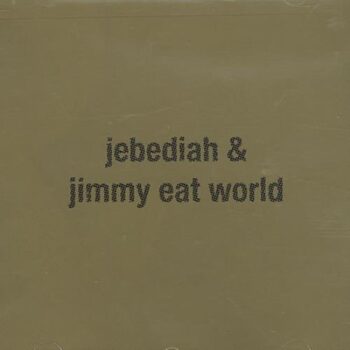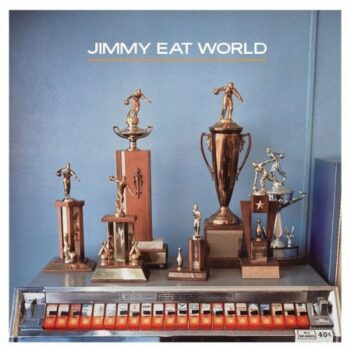
Nun also “Bleed American”, das Album, vor dem wohl nicht nur ich regelrecht Angst hatte. Angst, dass die Band unter der Last des Meilensteins erdrückt würde. Angst, dass Jimmy Eat World mit einer mittelmäßigen Platte langsam aber sicher den Fluss der ganz persönlichen Relevanz hinunter treiben. Den ersten Kardinalfehler begehe ich, als ich natürlich nicht die ruhige Minute abwarten kann, sondern die frisch angekommene CD hier im Büro einlege, auf halblaut stelle und mich in die Arbeit stürze. Eine Dreiviertel Stunde später ist es still. Ach, das war es schon? Viel hängen blieb da ja nicht. Andererseits: Das macht die meisten großen Platten aus. Lieblingsbands bekommen natürlich auch aufmerksamere Chancen, und nach dem fünften Durchgang ist “Bleed American” scheinbar endgültig verbucht als das poppige Hit-Album der Band mit zwei, drei nachdenklicheren Zwischentönen: sehr gut, sehr eingängig. Vielleicht zu eingängig? Im Geiste errechnet der Skeptiker in mir schon die Halbwertszeit der Songs und hofft, dass “Bleed American” einen zumindest über den Sommer tragen möge. Dass da was ist, was einen festhält und vielleicht nie mehr loslassen will, merkt man dann später: Ich freue mich einfach maßlos, wenn ich durch die Gänge laufe und aus irgendeinem Büro hier diese Platte erklingt (und das passiert oft), bleibe kurz stehen, tausche wissende Blicke aus, und gehe ein kleines bisschen glücklicher weiter. Es stimmt: Auf den ersten Blick sind sie leichter geworden. Das gewisse Etwas, dass diese Band auszeichnet, ist jedoch weiterhin vorhanden – vielleicht sogar mehr denn je. Denn eingängige (Pop-) Songs so auszustatten, dass sie im Lauf der Zeit nicht verlieren, sondern gewinnen, ist eine Kunst, die nicht viele beherrschen. Beispiele gefällig? “A Praise Chorus” ist die ersten 2:22 Minuten ein richtig schöner, zwingend arrangierter und komplett überzeugender Song mit catchy Hooks und klarer Textur, der so für sich stehen und Anerkennung einheimsen könnte, und auf den mindestens 90% der anderen Gitarrenmusik-mit-Popappeal-Bands stolz wie Oskar wären, hätten sie ihn denn geschrieben. Jimmy Eat World aber gehen zwei Schritte weiter und bauen eine Art Schlussrefrain ein, der einfach nur die Sonne aufgehen lässt: “crimson and clover / over and over” zitiert Jim Adkins die Sixties-Band Shondells, während ihm Promise Ring-Sänger Davey Bohlen, wie immer stets den charmanten Ton daneben, die harmonische Zweitstimme besorgt. Das Fazit lautet dann “want to fall in love tonight”, und wer bitteschön möchte da nicht mittun? “Hear You Me” hingegen ist ein im Wortsinne todtrauriger, gleichzeitig aber auch rührend schöner und reiner Song, der auch auf einer Trauerfeier alles andere als deplatziert wäre: “A song for a heart so big / god wouldnt let it live” heißt es hier, und wenn That Dog-Sängerin Rachel Haden glockenhell die Zeile may angels lead you in” haucht, weiß man genau, dass der Band hier mal wieder eine Keyline gelungen ist, die ähnlich wie der “dollar underwater” im Kreis der Verehrer auf ewig Bestand haben wird. Das folgende “If You Dont, Dont” ist dann wieder ganz beschwingter, feinfühliger Gitarrenpop, der auch beim exzessiven Hören nichts von seiner physischen Wirkung einbüßt. Wenn sich mittels der hell pulsierenden Gitarre der Pre-Chorus anbahnt, kommt sie: die Gänsehaut, ein ganz deutliches Gefühl der Euphorie und des Glücks, das so nur eine fantastische Melodie erzeugen kann. “Get It Faster” hingegen baut sich in den Strophen langsam auf, rockt hart und herzlich im Refrain, bis der Song im Mittelteil in eines der gigantischsten call-and-response-Metalriffgewitter übergeht, seit Ende der 80er die Haarspraybands den Planeten verlassen mussten. Danach “Cautioners”, das man schon von der Split-EP mit Jebediah kennt. Die Unterschiede sind im Grunde klein, in der Wirkung aber gewaltig: Auch hier ist es wieder Rachel Hadens Background-Gesang, fünf simple Töne, die den Song in engelsgleiche Sphären heben, und ihn so noch minutenlang im melodieempfänglichen Teil des Hörerhirns nachhallen lassen. Ich könnte noch stunden- und seitenlang weiterschwärmen. Wirklich jeder Song auf dieser Platte hat das große Extra an Harmonie, songwriterischen Kniffen und infektiösen Melodien parat, gespielt von einer Band, die sich gefunden hat und mit wirklich niemand anderem mehr verglichen werden muss. So klingen Jimmy Eat World und niemand anders. 50:58 Minuten, an denen es nichts, aber auch gar nichts auszusetzen gibt.
und wenn That Dog-Sängerin Rachel Haden glockenhell die Zeile “may angels lead you in” haucht, weiß man genau, dass der Band hier mal wieder eine Keyline gelungen ist, die ähnlich wie der “dollar underwater” im Kreis der Verehrer auf ewig Bestand haben wird. Das folgende “If You Dont, Dont” ist dann wieder ganz beschwingter, feinfühliger Gitarrenpop, der auch beim exzessiven Hören nichts von seiner physischen Wirkung einbüßt. Wenn sich mittels der hell pulsierenden Gitarre der Pre-Chorus anbahnt, kommt sie: die Gänsehaut, ein ganz deutliches Gefühl der Euphorie und des Glücks, das so nur eine fantastische Melodie erzeugen kann. Ich könnte noch stundenlang weiterschwärmen. Wirklich jeder Song auf dieser Platte hat das große Extra an Harmonie, songwriterischen Kniffen und infektiösen Melodien parat, gespielt von einer Band, die sich gefunden hat und mit wirklich niemand anderem mehr verglichen werden muss. 50:58 Minuten, an denen es nichts, aber auch gar nichts auszusetzen gibt.
weitere Platten
Surviving
VÖ: 18.10.2019
Integrity Blues
VÖ: 21.10.2016
Damage
VÖ: 07.06.2013
Invented
VÖ: 24.09.2010
Chase This Light
VÖ: 19.10.2007
Futures
VÖ: 11.10.2004
The Middle (Single)
VÖ: 17.07.2001
Clarity (Hall Of Fame)
VÖ: 29.01.2001
Clarity
VÖ: 29.01.2001
Splitsingle mit Jebediah
VÖ: 23.10.2000
Static Prevails
VÖ: 23.07.1996