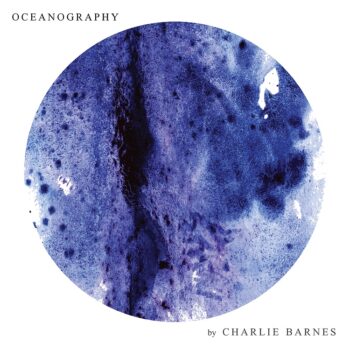
Die Sicherheit, mit der Barnes seine Songs auf “Oceanography” gebannt hat, lässt einen Masterplan vermuten. Der Mann im Hintergrund, Tour-Musiker bei Bastille und Kumpel von englischen Indie-Progrockern wie Amplifier und Oceansize, verfolgt seine Vision vom perfekten Popsong mit einer Konsequenz, die jedem Respekt abverlangt, der seinen Weg kreuzt. Vor diesem Hintergrund erscheinen die hymnischen, von Chören und stürmischen Refrains geprägten Stücke des neuen Albums wie eine weitere Zwischenstation auf dem Weg in den Pop-Olymp. Barnes? prägnante Stimme, sein Gespür für Satzgesang und die Energie, mit der seine Band in den besten Momenten wie eine entfesselte Version von Queen zu Zeiten von “Sheer Heart Attack” klingt, sind nach wie vor unschlagbare Pluspunkte. Allerdings hat sich auf dem Album auch ein gewisser Anteil musikalischer Beliebigkeit eingeschlichen, der Songs wie “Oceanography”, “The Departure” oder das unangenehm an Schlager erinnernde “Maria” auf dem schmalen Grat zwischen Hit und Schmonzette tänzeln lassen. Es ist der gleiche Effekt, der Bands wie Muse oder Biffy Clyro von einem Moment zum nächsten unerträglich macht: des Eindeutigen zu viel, der großen Gesten genug. Melodien für Millionen rocken nun mal nicht. Haben sie nie und werden sie nie. So solide “Oceanography” als Album auch ist, seine logische Konsequenz – irgendwas mit Abba – bekommt nicht mehr unbedingt Platz auf diesen Seiten.
weitere Platten
Last Night's Glitter
VÖ: 03.07.2020
More Stately Mansions
VÖ: 11.05.2015




