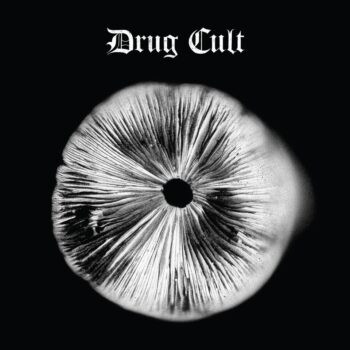
Was ist wichtiger: ein konzises Klangbild oder schlüssige Arrangements? Wem es bei Doom Metal nur um Heaviness geht, wer gerne auf Tranquilizern zu wabernder Psychedelik im abgedunkelten Zimmer rumhängt, dem könnten diese Australier Spaß machen. Gitarrist Vin Steele war mal einige Zeit bei Wolfmother – von deren Mastermind Andrew Stockdale hat er aber leider nicht gelernt, wie man einen Song auf den Punkt bringt und ihm erinnerungswürdige Momente verpasst. So mäandert der Drogenkult 42 Minuten lang durch den Nebelwald, zusammengehalten von einem schön ruschelig swingenden Schlagzeug und ausgestattet mit einem sagenhaft fuzzigen Bass-Sound – aber welcher Song läuft gerade? Ah, ist schon der nächste! Auf dem Klangbett bemüht sich Sängerin Aasha Tozer um Gesangslinien, scheitert aber mit ihrem weitgehend zufälligen Geleier auf ganzer Strecke. Texte wie Your blood is the drug Ive been searching for sollen wohl die rituelle Atmosphäre unterstreichen, wirken aber – wie das ganze Album – um Krassheit bemüht. Lediglich ein kleiner Ausflug ins Midtempo beim im Ansatz prägnanten “Acid Eye” lässt kurz aufhorchen. Vor wenigen Monaten erst haben die Berliner Treedeon gezeigt, wie man solche Art Extrem-Doom mit Wumms und Dynamik zum Leben bringen kann, Drug Cult sind das Gegenteil. Hier gibt es keine Abstufungen an Intensität, hier ist alles trist und egal. Vielleicht soll es so sein, vielleicht ist die Beliebigkeit Konzept – dann darf sich aber auch niemand wundern, wenn sich bei diesem Drogenritual der Kater schon während des Rausches einstellt.


