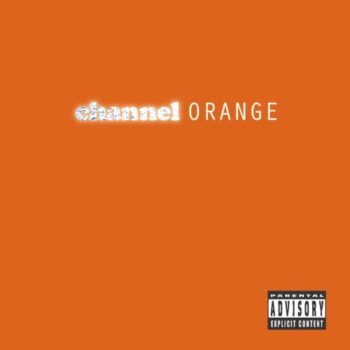
Frank Ocean ist nicht das erste Mitglied einer HipHop-Gruppe, das sich vom Bild des frauenvernichtenden Rap-Bodybuilders wegbewegt. Er ist aber der erste mit Starpotential, er könnte später mal Einfluss haben und zeigt jetzt schon, dass er damit umgehen kann. Wenn Ocean über seine unerwiderte Liebe zu einem Mann schreibt, denkt er nicht in Hetereo-, Schwul- oder Bi-Kategorien; es geht ihm darum, schwach und verletzlich sein zu dürfen, nicht einfach weiterzuziehen und auch mal im Mitsubishi zu weinen, der bald ein Bentley sein wird. “Channel Orange” handelt nie explizit von dieser Erfahrung, aber in jeder Sekunde von den Gefühlen, die dazu gehören. Für eine Soulplatte mit großen Charts-Hoffnungen ist es emotional ungewöhnlich komplex; selbst wenn der selbstgemachte Aufsteiger Ocean über reiche Kinder singt, stänkert er nicht nur, sondern findet die Dinge, nach denen sich selbst ein 16-Jähriger mit Schlafzimmer-Meeresblick vergeblich sehnt. Auch die Musik dazu sucht ihren eigenen Weg: Statt sich weiter am populären Gothic-RnB von The Weeknd oder Drake zu orientieren, der Oceans erstes Mixtape “Nostalgia, Ultra” geprägt hatte, kennt “Channel Orange” alle Tageszeiten und Lichtverhältnisse. Die kühle Weglasser-Musik von DAngelo steht hier gleichberechtigt neben Stevie Wonders Free-Hugs-Völlerei – nur die ganz kühnen Future-Soul-Hoffnungen kann Ocean lediglich einmal, im zehnminütigen “Pyramids” erfüllen. Erykah Badu bleibt ihr eigener Planet, alles andere wird sich von selbst erledigen.
weitere Platten
Blonde
VÖ: 20.08.2016



