Mammoth Penguins
There's No Fight We Can't Both Win
Text: Martin Burger
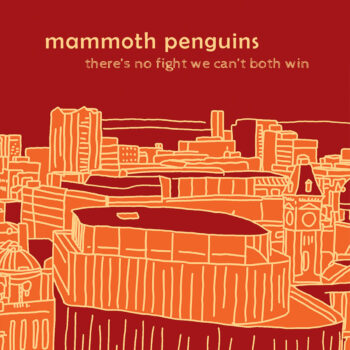
Im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern, besonders zum hochgradig unterhaltsamen Debüt “Hide And Seek” von 2015, schneidet “Theres No Fight We Cant Both Win” nämlich bestenfalls mittelmäßig ab. Damit zieht das Album zwar immer noch an der Masse der Konkurrenz vorbei, setzt sich aber nur an deren Spitze, statt um den Sieg zu wetteifern. Seit 2015 haben Waxahatchee, The Beths, Lemuria oder die drei Boygenius-Freundinnen einfach mehr Vielseitigkeit demonstriert, sowohl im Songwriting als auch stimmlich. Ohne Mammoth Penguins Emma Kupa, die eigentlich Emma Cooper heißt, zu nahe treten zu wollen, doch die interessanteren Stimmen haben andere; Augusta Koch von Cayetana etwa, oder Frances Quinlan von Hop Along. Kupas Lieblingsthemen sind Beziehungen und ihre Schattenseiten, über die sie zu simplem Gutwetter-Gitarrenpop mehr oder weniger kluge Überlegungen anstellt. Das orientiert sich an den Alben von 90er-Indie-Größen wie Penelope Houston und Kristin Hersh, deutlicher noch als bei den genannten Nachgeborenen, bringt neben den annehmbaren “There Is So Much More” und “Closure” aber allzu Beliebiges mit sich. “Dick Move” ist so ein laues Lüftchen, oder die Single “I Wanna”: Mehr als I wanna touch your hand/ Wanna look into your eyes/ I love you/ Fuck it all kann Kupa hier nicht zu Markte führen. Der Spielplatz, auf dem sich Mammoth Penguins austoben, wächst kontinuierlich um eine Vielzahl Sujets, Stimmungen und Arrangements an – Zeit, sich an ihnen auszuprobieren.





